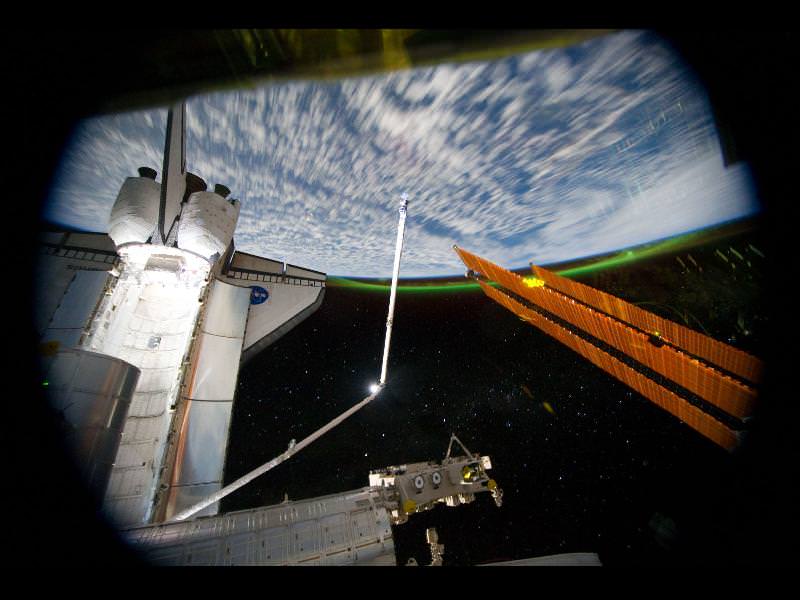Der Vorteil am Planet Erde ist seine einfache Erreichbarkeit. Auch wenn es aufregendere Orte im Sonnensystem gibt, ist doch kein anderer Planet dem Hobbyastronauten so preisgünstig zugänglich wie der blaue. Hier mein Expeditionsbericht von gestern:
Nur die Schwarzwaldtouristik bringt es fertig, aus einem 240x192 Meter großen Teich eine Attraktion zu machen, ein x-Sterne Hotel zu bauen und Busladungen voller Touristen Kuckucksuhren und Schwarzwälder Schinken anzudrehen.
Vor dem Massentourismus war der über 1.000 Meter hoch im schwarzen Wald gelegene
Mummelsee offensichtlich ein bezaubender Ort, der irgendwie gut ins Elbenland von
Herr der Ringe gepasst hätte. Das lässt jedenfalls sein mittelalterlicher Name Lacus Mirabilis (Wundersee) vermuten. Man erzählt sich Geschichten von Nixen und einem Seekönig und "hilfreichen Seeweiblein". Der Romantiker Eduard Mörike fühlte sich zum Gedicht
Die Geister am Mummelsee inspiriert.
Lässt man das x-Sterne Hotel rechterhand liegen, begibt man sich über einen reizvollen Wanderweg zum Aufstieg zur
Hornisgrinde. Hier ein Schnappschuss vom malerischen Ausblick beim Aufstieg:
Die Hornisgrinde ist mit 1164 Meter Höhe der höchste Berg im Nordschwarzwald. Mit seinem langen kahlen Bergrücken und der tief in den so genannten Biberkessel abfallenden Flanke erinnert der Berg sehr an sein südliches Pedant, dem Feldberg. Auch dort haben wir ein Komposit aus flachen Rücken und
Karsee, dem Feldsee. Beide Landschaften wurden in der letzten Eiszeit geformt. Große Gletschermassen erodierten die Berge zu langen flachen Rücken. Wo das Eis von den steilen Flanken auf flacheres Gelände trifft, "hobelt" es Vertiefungen aus, die
Kare, in denen sich heute das Wasser staut. Während der Feldsee am Feldberg und der Mummelsee an der Hornisgrinde noch echte Seen sind, ist der Biberkessel zu einem Moor verlandet. Typisch für Karseen wie Feld- und Mummelsee ist ihre Artenarmut: Nur wenige Spezialisten können in diesen nährstoffarmen Gewässern leben.
Charakteristisch für die Hornisgrinde ist das Hochmoor auf dem Gipfel. Obwohl der Feldberg höher als die Hornisgrinde ist, fällt doch auf den nördlicheren der beiden Berge mehr Niederschlag. Das liegt daran, dass auch die Vogesen im Westen auf der anderen Rheinseite niedriger sind, als im Südschwarzwald. Somit stellt die Hornisgrinde das erste nennenswerte Hindernis für die Wolken aus dem Atlantik dar, weshalb es zu viel Aufwindniederschlag kommt. Da die Hornisgrinde bis auf den Buntsandstein erodiert ist, gibt es keine wasserführenden Schichten. Das Wasser staut sich also auf dem relativ flachen Bergrücken und es bildet sich eine Moorvegetation.
Das Bild zeigt einen typischen Eindruck der noch braunen Vegetation im Frühjahr (mancherorts liegt hier noch Schnee). Bei den "Sträuchern" handelt sich um Bergkiefern der Unterart
Latsche.
Das Hochmoor ist ständig gefährdet: Wenn beispielsweise Wanderer quer zu den Wegen laufen, schaffen sie Trittspuren, die als Wasserleiter das Moor entwässern. Dann siedeln sich Strauchgewächse an und schließlich die Pionierpflanzen des Waldes, zum Beispiel Birken. Daher wird inzwischen viel Wert darauf gelegt, die Touristenströme sorgsam über den Berg zu führen und durch einen sehr schönen Lehrpfad aufzuklären.
Leider lässt sich auf diesem Bild die grandiose Fernsicht nur sehr wage erahnen, die man von der Hornisgrinde auf das Rheintal hat.
Aber das war sicherlich nicht mein letztes Foto von diesem Berg. Diese Fernsicht diente 1722 der Landvermessung. Der Dreifürstenstein auf der Hornisgrinde markierte die Grenzlinien der an diesem Punkt damals aufeinanderstoßenden Länder Markgrafschaft Baden, Herzogtum Württemberg und dem Fürstbistum Straßburg.
Verschandelt wir die Hornisgrinde durch eine Windkraftanlage, die wie das Exemplar unten sich dadurch auszeichnet, dass sie immerzu stillzustehen scheint.
Als Laie hab ich oft den Eindruck, dass die Ernte von Windkraft im Schwarzwald gut gemeint, aber schlecht durchdacht ist. Wind ist hier einfach sehr unregelmäßig. Ich lasse mich da aber gerne eines besseren belehren, wenn ich mich irren sollte, denn letztlich ist die Wahrnehmung subjektiv: Wenn es richtig windet, geht man ja auch nicht wandern - es sei denn an der Küste, wo es eben immer windet.
Kleiner Einkehrtipp. Neben der auf Tourismus ausgerichteten Gastronomie am Mummelsee gibt es eine große Hütte am Ochsenlager auf der anderen Seite des Bergrückens. Da lohnt es sich vorbeizuschauen. Das Rothaus schmeckt aber auf beiden Seiten der Hornisgrinde gleich.