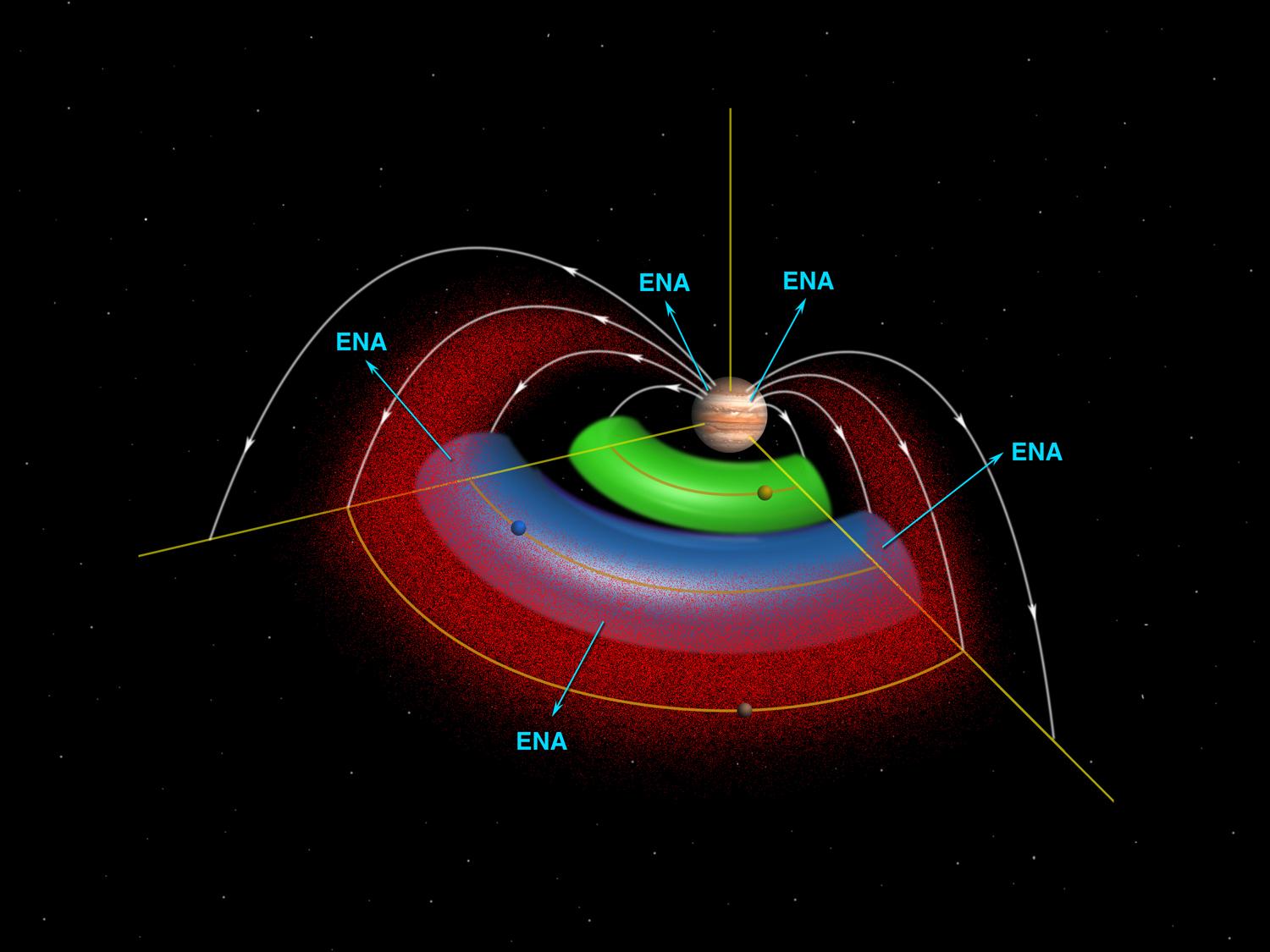|
| Bild: Fred Espenak, aufgenommen am 1. April 2020 in Arizona, USA |
Wenn aus unserer irdischen Perspektive die Venus der Sonne hinterherläuft, geht sie erst nach der Sonne im Westen unter. Sie erscheint uns dann als Abendstern. Ein sehr helles Objekt, das bereits in der Dämmerung sichtbar wird, aber noch vor der zweiten Nachthälfte untergeht.
Die Venus hatte bereits am 24. März ihren größten Winkelabstand (größte östliche Elongation) von 46° von der Sonne erreicht. Ihre größte Helligkeit erreicht die Venus aber erst Ende April (-4,8 mag). Das Planetenscheibchen ist dann 39 Winkelsekunden groß und zeigt sich im Teleskop zu 25% beleuchtet. Die Venus zeigt also eine schöne Sichel, wie wir sie sonst nur vom Mond kennen.
Wie es zur Sichel, also den Phasen der Venus kommt und sich auch die scheinbare Größe des Planetenscheibchens ändert, verdeutlicht diese Grafik aus dem Kosmos Himmelsjahr 2020:
 |
| Die Lichtgestalten der Venus. Quelle: Kosmos Himmelsjahr 2020, Kosmos-Verlag |
Seit dem 30. März befindet sich die Venus im Sternbild Stier und hier kann sie was erleben! Sie begegnet den Offenen Sternhaufen der Plejaden, dem Sternhaufen der Hyaden und dem Riesenstern Aldebaran, dem roten Auge des Stiers. Es lohnt sich also in den kommenden Abenden mit einem Fernglas die Venus aufzusuchen und zu schauen, in welcher Umgebung sie sich gerade tummelt.
In dem Bild oben steht die Venus etwas südlich des Offenen Sternhaufens der Plejaden, an dem sie am 03. April vorbeiziehen wird. Man beachte die kosmischen Dimensionen: Während die Venus unser unmittelbarer Nachbar ist, der uns mit 38 Millionen Kilometern Entfernung deutlich näherkommen kann als der Mars mit seiner minimalen Distanz von 56 Millionen Kilometern, sind die Plejaden ein Objekt weit jenseits unseres Sonnensystems. Von diesem Offenen Sternhaufen trennen uns etwa 440 Lichtjahre, das sind 4.400 Billionen Kilometer!
So eine Entfernung kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Für einen Sternhaufen stehen uns die Plejaden aber recht nahe. Der Haufen ist sogar etwas näher als die Praesepe im Sternbild Krebs. Dank ihrer relativen Nähe kann man die hellsten Sterne der Plejaden einzeln unterscheiden. Man spricht daher auch vom Siebengestirn und hat den Sternen Eigennamen gegeben. Es handelt sich um die Töchter des Riesen Atlas mit der Pleione (nach Hesiod) mit so klangvollen Namen wie Alcyone, Maia und Electra. Diese Karte zeigt die Plejaden mit den Eigennamen der hellsten Sterne, sowie der Lage der Venus in den kommenden Tagen:
 |
| Digital Illustration Credit & Copyright: Fred Espenak (Bifrost Astronomical Observatory) |
Ein Offener Sternhaufen wie die Plejaden ist eine Art Sternkindergarten. Die mythologischen Geschwister sind also echte Sternschwestern, hervorgegangen aus einer riesigen Wolke aus Gas und Staub. Der Kindergarten umfasst etwa 500 Sterne, die circa 100 Millionen Jahre alt sind. Im Vergleich zu unserer fast fünf Milliarden Jahre alten Sonne sind dies wirklich sehr junge Sterne!
Am 17. April zieht die Venus etwa 10° nördlich des hellen Roten Riesen Aldebaran vor, ein Stern, der den 44-fachen Durchmesser unserer Sonne hat!
Dieser Stern markiert die Lage eines Offenen Sternhaufens, der uns so nah ist, dass er fast nicht als Haufen zu erkennen ist. Es sind die Hyaden. Sie befinden sich "nur" 150 Lichtjahre von uns entfernt. Mit dem Stern Aldebaran hat unsere kosmische Entfernungsleiter eine weitere Sprosse: Er gehört nur scheinbar zu den Hyaden-Sternen, ist aber in Wirklichkeit nicht einmal halb so weit von uns entfernt. Beim Anblick solcher schöner Himmelskonstellationen sollte man sich diese dritte Dimension immer vergegenwärtigen.